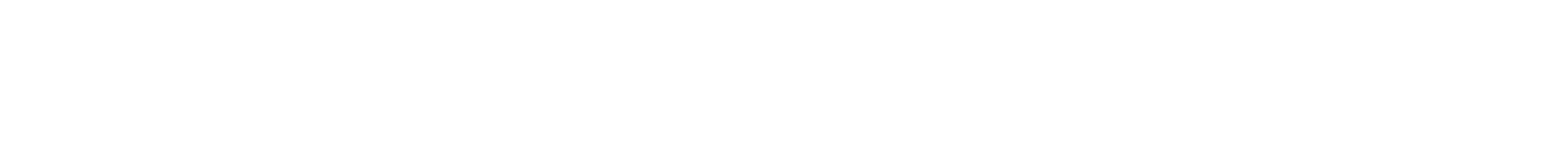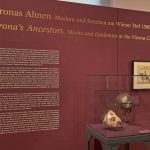der Karl Borromäus Brunnen im 3. Bezirk
Der Karl Borromäus Brunnen, am Platz vor dem Bezirksamt des 3. Bezirkes, wurde 1904 zum 60. Geburtag von Bürgermeister Karl Lueger gestiftet und der Grundstein gelegt. Karl Borromäus ist sein Namenspatron und der Platz wurde auch auf Karl Borromäus Platz umbenannt. Fertiggestellt und eröffnet wurde der Brunnen schließlich 1909. Die ganze Anlage stellt ein bemerkenswertes Gesamtkonzept dar, mit der kreisrunden Einfassung und dem abgesenkten Brunnenbereich. Es ist auch eine bliebte regionale kühle Stadtoase.